Topic: Klang
Von Nord kommt der Sturm und lässt Fenster und Kamin brummen. Jetzt soll eine Zeit des Rückzugs sein. Nächste Woche begebe ich mich wieder nach Bursfelde. Im letzten Jahr war ich dreimal dort einquartiert, einmal mit G., einmal mit dem Bildhauer und ein weiteres Mal mit beiden. Mit G., die in einer Sufi-Tradition meditiert, führe ich die kleine Meditationsgruppe weiter, die ich mit der Buddhistin begonnen hatte. Mit dieser habe ich fast das ganze Jahr keinen Kontakt mehr gehabt. Ich kann nur ahnen, was sie bewogen hat, unsere Kameradschaft zu beenden, und ich merke, dass mich unsere Stille erleichtert. In der Rückschau erkenne ich, wie sehr wir aneinander vorbeigeredet haben in dem Sinne, dass meine spirituelle Absicht mit ihren psychosozialen Selbstoptimierungsbemühungen unvereinbar waren. Diese Gespräche waren sehr anstrengend und haben mich oft schlaflos zurückgelassen, weil ich keine Lösung finden konnte. Weil es keine Lösung gab.

Das Kloster Bursfelde liegt einsam an der Weser auf der Höhe von Göttingen. Die romanische Kirche feierte im letzten Jahr ihr 925-jähriges Bestehen, und da weder Krieg noch geografisches Geschiebe des Urstromtales dem Gebäude etwas anhaben konnten, ist es, bis auf hölzernes Dachgestühl und Glasfenster, wohl im Originalzustand. Alte Fresken wurden freigelegt, es gibt eine Ost- und eine Westseite unterschiedlicher Bauphasen, einen Innenhof und anliegendes Gelände mit Pilgerherberge, Fischteich, Obstbäumen, Blumenbeeten und Schafsweiden. Der Pastor wohnt mit seiner Familie in einem Nebengebäude, auf das man schaut, wenn man sich unterm Dach völlig selbstbestimmt einmietet in der sogenannten Oase, mit schönen Zimmern nebst Dachbalken und hübschen Holzmöbeln, dazu eine vollausgestattete Küche für Selbstversorger, in der der Bildhauer uns schon manchen Apfelkuchen gebacken hat.
Hinter der Wiese fließt die Weser, gleichmäßig und unerschöpflich. Beim letzten Abendgang an ihr Ufer hegte ich oft einen Gedanken, ob der Fluss weiterfließt oder, ökologisch wassersparend, über Nacht abgedreht würde, so als wäre fließendes Wasser ohne Nutzung oder Betrachter reine Verschwendung. Tatsächlich bewegt mich auf eine unergründliche Weise die Idee, dass ein Fluss überhaupt fließt, als ein eigenes Wesen, das sich dort durchs Bergland windet.
Im Seitenschiff des östlichen Gebäudeteils markiert ein großer handgewebter Wollteppich einen Meditationsbereich. Dort habe ich Stunden gesessen, mich selbst belauscht oder die Atmosphäre und den ganz eigenen Klang der Kirche – es ist eine Art Raum-Rauschen, das das Körpergefühl erweitert und ehrfürchtig macht. Das Glockenläuten hingegen erzeugt neben seinen Klangwellen ein hölzernes Rumpeln mit einer Ahnung des Gewichts, das auf den Glockenstuhl einwirken muss. Wenn dann alles ganz Stille war, kein pilgernder Besucher sich lauthals über die Historie des Ortes ergehen muss, dann habe ich ab und zu ein hauchwinziges Beben im Boden spüren können. Ein Moment größter Intimität mit dem Ort und der Stelle, an der mein Körper ihn berührt. Ich saß dort mehrmals am Tag lange mit großer Mühelosigkeit und leichtem Herzen.

Das Kloster Bursfelde liegt einsam an der Weser auf der Höhe von Göttingen. Die romanische Kirche feierte im letzten Jahr ihr 925-jähriges Bestehen, und da weder Krieg noch geografisches Geschiebe des Urstromtales dem Gebäude etwas anhaben konnten, ist es, bis auf hölzernes Dachgestühl und Glasfenster, wohl im Originalzustand. Alte Fresken wurden freigelegt, es gibt eine Ost- und eine Westseite unterschiedlicher Bauphasen, einen Innenhof und anliegendes Gelände mit Pilgerherberge, Fischteich, Obstbäumen, Blumenbeeten und Schafsweiden. Der Pastor wohnt mit seiner Familie in einem Nebengebäude, auf das man schaut, wenn man sich unterm Dach völlig selbstbestimmt einmietet in der sogenannten Oase, mit schönen Zimmern nebst Dachbalken und hübschen Holzmöbeln, dazu eine vollausgestattete Küche für Selbstversorger, in der der Bildhauer uns schon manchen Apfelkuchen gebacken hat.
Hinter der Wiese fließt die Weser, gleichmäßig und unerschöpflich. Beim letzten Abendgang an ihr Ufer hegte ich oft einen Gedanken, ob der Fluss weiterfließt oder, ökologisch wassersparend, über Nacht abgedreht würde, so als wäre fließendes Wasser ohne Nutzung oder Betrachter reine Verschwendung. Tatsächlich bewegt mich auf eine unergründliche Weise die Idee, dass ein Fluss überhaupt fließt, als ein eigenes Wesen, das sich dort durchs Bergland windet.
Im Seitenschiff des östlichen Gebäudeteils markiert ein großer handgewebter Wollteppich einen Meditationsbereich. Dort habe ich Stunden gesessen, mich selbst belauscht oder die Atmosphäre und den ganz eigenen Klang der Kirche – es ist eine Art Raum-Rauschen, das das Körpergefühl erweitert und ehrfürchtig macht. Das Glockenläuten hingegen erzeugt neben seinen Klangwellen ein hölzernes Rumpeln mit einer Ahnung des Gewichts, das auf den Glockenstuhl einwirken muss. Wenn dann alles ganz Stille war, kein pilgernder Besucher sich lauthals über die Historie des Ortes ergehen muss, dann habe ich ab und zu ein hauchwinziges Beben im Boden spüren können. Ein Moment größter Intimität mit dem Ort und der Stelle, an der mein Körper ihn berührt. Ich saß dort mehrmals am Tag lange mit großer Mühelosigkeit und leichtem Herzen.
akrabke | 08. Januar 2019, 15:08 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: Nah
Das Jahr geht heute zu Ende und es war ein gutes Jahr. Vielleicht sogar das beste seit 2011.


- Kloster Bursfelde, mein liebster Rückzugsort; die Weser
- Der Grüne Mann als urban knitting-Projekt im Berggarten
- jede Menge Wolle an heißen Tagen
- was denn nun eigentlich Kunst sei
- Freundschaften on, Freundschaften off
- immer wieder Mama
- Traumakotzen mit Dudi
- neue, teils seltsame Projekte, sogar incl. Geldverdienen
- und immer wieder der wunderbare Bildhauer, mein bester Freund
Topic: Nah
Schon wieder. Wie die letzten dachte ich auch dieses Jahr, ich würde es als Waise erleben. Die Mutter ist geradezu kregel, spricht wieder mehr, und auf dem gestrigen Weihnachtsmarkt des Heimes fand sie eine Kette mit Holzanhänger für sich genau richtig. Daran interessierte sie hauptsächlich die Lederschnur und nicht das feinpolierte Stück Olivenholz, das ich für sie ausgesucht hatte. Ich selbst erwarb ein Fläschchen vom Likör, den die Gartengruppe vor Wochen angesetzt hatte, zusätzlich eine wirklich lustig-bunt gestrickte Türwurst, der Winter kann also kommen. Draußen am Gartenhäuschen mit Korbfeuer gab es Glühwein und Weihnachtslieder, die kleine Mutter dick eingemummelt (ist das dein Mantel? fragte sie), singt laut mit und ich auch.
Ein Bewohner, den ich noch nicht kannte, zeigte sich wortgewand und witzig. Es war fast, als würde er flirten, und zwar mit allen, das regte etwas Freches an in mir. Er gestand, dass er oft Dinge vergessen würde, das wäre halt so im Alter (84), und auf eine seltsame Weise entschwanden manchmal die in subtile Richtungen gelenkten Gespächsthemen, die auch mir sofort entschlüpften, so als wäre ich Teil eines telepathischen Schauspiels. Auch die Mutter, scheinbar in die Betrachtung des Feuers versenkt, bringt unser Gespräch zum Kichern.
Nachdem ich sie zum Abendbrot hineingebracht hatte, ging ich auf einen weiteren Glühwein hinaus, es war erst kurz vor fünf, und als mir dieser Herr wieder entgegenkam, rutschte mir ein na, sind Sie noch gar nicht im Bett? raus, das er sehr charmant parierte.
Auf dem Angehörigenabend letzte Woche wurden Neuerungen kundgemacht und natürlich auch ein bisschen Werbung fürs Heim. Ich bin mehr denn je überzeugt, einen wirklich guten Ort für Mama gefunden zu haben, und wieder erstaunt mich, dass wir keinerlei Wartezeit überbrücken mussten, an einem Freitagnachmittag hatte ich mich mit der Pflegedienstleitung getroffen, das Zimmer angesehen, weiteres besprochen und am darauffolgenden Dienstag ist Mama eingezogen.
Das Heim will eine Rikscha anschaffen, mit E-Motor-Dings, den Angehörigen zur Ausleihe, außerdem eine Männer-Werkstatt einrichten, denn die Jungs haben keine Lust auf Häkel- oder Gartengruppe. Sie wollen was Richtiges machen. Es gibt auch einige Mitmach-Kästen, Hands on Demenz, da können Interessierte erfahren, wie sich Demenz anfühlt, z. B. zeichnet man ein Gesicht oder eine einfache geometrische Form (nach), während die Bewegungen der eigenen Hände über einen Spiegel seitenverkehrt zu sehen sind. Das haut überhaupt nicht hin! Oder man muss mit einem Löffel Glasmurmeln aus einem Teller in ein Becherlein schaufeln. So also ist das.
Meine Schwester Dudi war lange nicht da. Das letzte Mal im September oder so, wir hatten uns beide im Heim mit einer bösen und sehr schnellen Magen- und Darmsache infiziert, und die Erinnerung an gemeinsames Kotzen zu Nacht scheint uns beiden so traumatisch, dass wir ein nächstes Treffen immer wieder verschoben haben. Ein kleines bisschen hatten wir uns auch gezankt: ich will nämlich nicht mehr, dass sie länger als zwei Nächte bleibt, denn wo ich eigentlich etwas Erleichterung mit Mama suche, empfinde ich unsere Zusammenkünfte als fast noch stressiger – immer wieder muss über den Mann geredet werden, der nicht so will wie sie oder über den Sohn, der Sachen macht, die wir nicht gutheißen können. Geredet heißt, ununterbrochen geredet, das heißt auch, dass ich ununterbrochen Ratschläge gegen die schwesterliche Misere zum Besten gebe, die im Sande verlaufen. Könnte ich mir sparen, ich weiß.

Und trotz alldem ist das Leben auf eine wunderliche Weise wieder schön und leichter. Alles, wofür ich gearbeitet habe, scheint sich ganz mühelos zu erfüllen, und ich bin voller Hoffnung und Freude.
Ein Bewohner, den ich noch nicht kannte, zeigte sich wortgewand und witzig. Es war fast, als würde er flirten, und zwar mit allen, das regte etwas Freches an in mir. Er gestand, dass er oft Dinge vergessen würde, das wäre halt so im Alter (84), und auf eine seltsame Weise entschwanden manchmal die in subtile Richtungen gelenkten Gespächsthemen, die auch mir sofort entschlüpften, so als wäre ich Teil eines telepathischen Schauspiels. Auch die Mutter, scheinbar in die Betrachtung des Feuers versenkt, bringt unser Gespräch zum Kichern.
Nachdem ich sie zum Abendbrot hineingebracht hatte, ging ich auf einen weiteren Glühwein hinaus, es war erst kurz vor fünf, und als mir dieser Herr wieder entgegenkam, rutschte mir ein na, sind Sie noch gar nicht im Bett? raus, das er sehr charmant parierte.
Auf dem Angehörigenabend letzte Woche wurden Neuerungen kundgemacht und natürlich auch ein bisschen Werbung fürs Heim. Ich bin mehr denn je überzeugt, einen wirklich guten Ort für Mama gefunden zu haben, und wieder erstaunt mich, dass wir keinerlei Wartezeit überbrücken mussten, an einem Freitagnachmittag hatte ich mich mit der Pflegedienstleitung getroffen, das Zimmer angesehen, weiteres besprochen und am darauffolgenden Dienstag ist Mama eingezogen.
Das Heim will eine Rikscha anschaffen, mit E-Motor-Dings, den Angehörigen zur Ausleihe, außerdem eine Männer-Werkstatt einrichten, denn die Jungs haben keine Lust auf Häkel- oder Gartengruppe. Sie wollen was Richtiges machen. Es gibt auch einige Mitmach-Kästen, Hands on Demenz, da können Interessierte erfahren, wie sich Demenz anfühlt, z. B. zeichnet man ein Gesicht oder eine einfache geometrische Form (nach), während die Bewegungen der eigenen Hände über einen Spiegel seitenverkehrt zu sehen sind. Das haut überhaupt nicht hin! Oder man muss mit einem Löffel Glasmurmeln aus einem Teller in ein Becherlein schaufeln. So also ist das.
Meine Schwester Dudi war lange nicht da. Das letzte Mal im September oder so, wir hatten uns beide im Heim mit einer bösen und sehr schnellen Magen- und Darmsache infiziert, und die Erinnerung an gemeinsames Kotzen zu Nacht scheint uns beiden so traumatisch, dass wir ein nächstes Treffen immer wieder verschoben haben. Ein kleines bisschen hatten wir uns auch gezankt: ich will nämlich nicht mehr, dass sie länger als zwei Nächte bleibt, denn wo ich eigentlich etwas Erleichterung mit Mama suche, empfinde ich unsere Zusammenkünfte als fast noch stressiger – immer wieder muss über den Mann geredet werden, der nicht so will wie sie oder über den Sohn, der Sachen macht, die wir nicht gutheißen können. Geredet heißt, ununterbrochen geredet, das heißt auch, dass ich ununterbrochen Ratschläge gegen die schwesterliche Misere zum Besten gebe, die im Sande verlaufen. Könnte ich mir sparen, ich weiß.

Und trotz alldem ist das Leben auf eine wunderliche Weise wieder schön und leichter. Alles, wofür ich gearbeitet habe, scheint sich ganz mühelos zu erfüllen, und ich bin voller Hoffnung und Freude.
akrabke | 02. Dezember 2018, 11:15 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: Musik
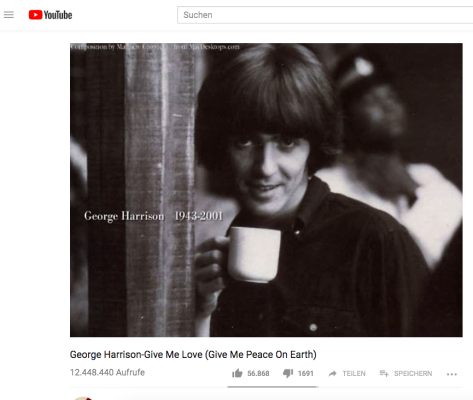
Nova Meierhenrich spricht mit Judith Rakers in der letztwöchigen Ausgabe der NDR-Talkshow über ihren depressiven Vater. Es berührt mich (in der Nachschau bei Frühstücksei und Kaffee), wie sehr die Krankheit alle Familienmitglieder buchstäblich gebannt hat und welche Parallelen es zu meiner Mutter bzw. zu meiner Familie gibt – dass man (also sie oder ich) praktisch kaum eigenen Interessen nachgehen kann, weil der über allem schwebende Todeswunsch des Vaters (bzw. die Ignoranz meiner Mutter) alle Kraft und Liebe absorbiert. Als sie sagt, sie würde nach all den langen Jahren jetzt erst zu sich finden, kommen mir die Tränen.
Am neu eingerichteten Reformationstag besuche ich die Mutter und finde sie im Tagesraum mit einer großen hässlichen Puppe auf dem Schoß. Man kann die eigenen Hände in Kopf und Handschuh stecken und durch entsprechende Bewegungen dem Gegenüber den Anschein vermitteln, die Puppe sei lebendig. Ich kann nicht herausfinden, ob Mama glaubt, die Tante, wie sie dieses seltsame Dings nennt, sei wirklich lebendig, jedenfalls spricht sie unaufhörlich mit ihr, während ich Blumen versorge und etwas aufräume. Was sie sagt, klingt völlig wirr, von jedem ihrer üblichen Sätze ein Teil, aber ich nehme ihren Stolz wahr, dass jenes Dings am liebsten bei ihr sei. In der Nachschau kommen mir wieder Tränen, wenn ich mir vorstelle, wie ein/e Designer/in versucht hat, dieses Objekt zu gestalten, machen'Se mal, Ihnen wird schon was Passendes einfallen. Ich verstehe schon nicht, was das für eine Frisur sein soll, mit so Zotteln an der Seite, ganz zu schweigen von der Knollennase, dem beigefarbenen Hautstoff, der blöden Jeansjacke und den beknackten zu engen Schuhen. Was, wenn Mama im Moment des Todes in diese ach so glänzenden Knopfaugen blickt und dieser Blick gleich ihr Karma fürs nächstes Leben bestimmt, immer auf der lebenslangen Suche nach zufriedenstellendem Modedesign (oder Flucht vor hässlichen Demenzpuppen) – wo sie selbst doch hip und Hutmacherin war, und in den 50er Jahren dafür gesorgt hat, dass betuchte Damen schickes auf den ondulierten Haaren trugen. (Vielleicht bin auch ich ja bloß auf der Suche nach gutem Design, nach Schönheit und Freude, wer weiß, was ich als letztes zu sehen bekommen habe.)
Ich brauche buchstäblich den ganzen Tag, um mich davon zu erholen und lege stundenlang Patiencen: 40 Räuber, die sowieso nie aufgehen, wenn man sie in der schwierigen Variante spielt. Gottogott, give me love, give me peace on earth, give me life, keep me free from birth (George Harrison). Und: help me cope with this heavy load. Demenzpuppen -!
Topic: Heim sweet Heim
Das Heim der Busenfreundin ist bekanntlich eine Müllhalde. Ich bot an, ihr beim Aufräumen, Sortieren und Wegwerfen zu helfen. Balkon, Küche und Schlafzimmer hat sie selbst bearbeitet. Gestern begannen wir mit dem Wohnzimmer, das zu durchschreiten kaum noch möglich ist. Wir beide haben unterschiedliche Sortierideen, aber sie ist froh, dass wir überhaupt anfangen, und so schaffen wir es über Stunden, uns nicht zu zanken – nur ab und zu heben wir leicht die Stimmen.

Es ist einiges in den Ecken zu finden. Zwischen Staub und Ausgeschüttetem, fest oder flüssig, entdecken wir Stapel von Papieren, die lt. Datum seit 2013 genau da so liegen. Rechnungen, ungeöffnete Briefe, Notizen. Außerdem bringt sie von ausnahmslos jedem Ereignis, das sie besucht, Flyer oder Kataloge mit, und wie nach und nach deutlich wird, hat sie eigentlich alles seit fünf Jahren einfach ins Zimmer geworfen, oder gelegt, manches ist hinters Sofa gerutscht, Geschirr unter Schichten zerbrochen, Bücher und Fotos verknickt und zerfleddert.
Ich weiß nicht genau, warum ich mir das antue, aber irgendwie habe ich Bock. Sie hatte neulich eine feng shui-Praktizierende zu Rate gezogen und danach kam einiges in Bewegung. Vielleicht ist es so eine Art Leben retten, obwohl ich das ja nicht mehr mache. Leben retten.
Wo sie chinesische Beraterinnen beauftragt, mache ich allerdings Ähnliches. Meine Nichte (2. Grades) hatte eine Art Heilerin, so nenne ich sie für mich, M., zu einem Problem befragt, und die Antworten des Seelenlesens hatten mich von Wahrhaftigem überzeugt. Die Heilerin sieht und kommuniziert auf einer Ebene, wo Lebewesen (Mensch und Tier) nicht selbst sprechen können.
Meiner Mutter ginge es gut, sie würde nicht unter ihrer Situation leiden. Mama hätte wohl aber noch Dinge zu bearbeiten und Sterben sei für sie keine Option, in unserer Familie würde man sich eben irgendwie durchbeißen, anstatt sich zu verabschieden. Es wären einige Wesen um sie, devas, Engel, wie auch immer, die sie einladen würden hinüberzukommen, aber sie kann noch nicht (loslassen). Es wären noch viele lose Enden unbearbeiteter Sachen (wie soll man sowas nur nennen), die sie nicht zur Ruhe kommen lassen. Diese losen Enden versucht M. zu ordnen in einem Prozess, der noch andauert, immer wieder wendet sie sich der Seelenebene zu und klärt und reinigt. Ich selbst muss dabei nichts tun. Vielleicht sitze in zur gleichen Zeit in Meditation und konzentriere mich, und beim letzten Mal bin ich nach einer Stunde fast wütend aufgesprungen und habe mich gefragt, was ich da eigentlich tue. Hinter der Mutter aufräumen. Ihr Leben retten. Mache ich nur schon so lange, wahrscheinlich mein ganzes Leben.
Wo immer ich versuche, ganz bei mir zu sein, in der Meditation, bei der Gestaltungsarbeit oder beim Verfolgen von künstlerischen, literarischen oder anderen Interessen, bin ich wirklich glücklich. Es ist Zeit.

Es ist einiges in den Ecken zu finden. Zwischen Staub und Ausgeschüttetem, fest oder flüssig, entdecken wir Stapel von Papieren, die lt. Datum seit 2013 genau da so liegen. Rechnungen, ungeöffnete Briefe, Notizen. Außerdem bringt sie von ausnahmslos jedem Ereignis, das sie besucht, Flyer oder Kataloge mit, und wie nach und nach deutlich wird, hat sie eigentlich alles seit fünf Jahren einfach ins Zimmer geworfen, oder gelegt, manches ist hinters Sofa gerutscht, Geschirr unter Schichten zerbrochen, Bücher und Fotos verknickt und zerfleddert.
Ich weiß nicht genau, warum ich mir das antue, aber irgendwie habe ich Bock. Sie hatte neulich eine feng shui-Praktizierende zu Rate gezogen und danach kam einiges in Bewegung. Vielleicht ist es so eine Art Leben retten, obwohl ich das ja nicht mehr mache. Leben retten.
Wo sie chinesische Beraterinnen beauftragt, mache ich allerdings Ähnliches. Meine Nichte (2. Grades) hatte eine Art Heilerin, so nenne ich sie für mich, M., zu einem Problem befragt, und die Antworten des Seelenlesens hatten mich von Wahrhaftigem überzeugt. Die Heilerin sieht und kommuniziert auf einer Ebene, wo Lebewesen (Mensch und Tier) nicht selbst sprechen können.
Meiner Mutter ginge es gut, sie würde nicht unter ihrer Situation leiden. Mama hätte wohl aber noch Dinge zu bearbeiten und Sterben sei für sie keine Option, in unserer Familie würde man sich eben irgendwie durchbeißen, anstatt sich zu verabschieden. Es wären einige Wesen um sie, devas, Engel, wie auch immer, die sie einladen würden hinüberzukommen, aber sie kann noch nicht (loslassen). Es wären noch viele lose Enden unbearbeiteter Sachen (wie soll man sowas nur nennen), die sie nicht zur Ruhe kommen lassen. Diese losen Enden versucht M. zu ordnen in einem Prozess, der noch andauert, immer wieder wendet sie sich der Seelenebene zu und klärt und reinigt. Ich selbst muss dabei nichts tun. Vielleicht sitze in zur gleichen Zeit in Meditation und konzentriere mich, und beim letzten Mal bin ich nach einer Stunde fast wütend aufgesprungen und habe mich gefragt, was ich da eigentlich tue. Hinter der Mutter aufräumen. Ihr Leben retten. Mache ich nur schon so lange, wahrscheinlich mein ganzes Leben.
Wo immer ich versuche, ganz bei mir zu sein, in der Meditation, bei der Gestaltungsarbeit oder beim Verfolgen von künstlerischen, literarischen oder anderen Interessen, bin ich wirklich glücklich. Es ist Zeit.
akrabke | 23. Oktober 2018, 09:18 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: Arbeitstisch

Die lokale Presse berichtet leider unfachlich und äußerst langweilig über die Ausstellung im Garten. Trotzdem bin ich beglückt darüber, dass ich mitgemacht habe und mein Objekt nun öffentlich zu sehen ist. Das schönste Lob bekam ich von einer 83-jährigen Dame, die Jahrzehnte in Schottland als Kunstwissenschaftlerin und Archäologin tätig war, und die, mich umarmend, meine Arbeit freudig zur Kenntnis nahm – jene Figur, die ich darzustellen versucht habe, war ihr sehr vertraut. Vielen anderen ist sie nicht geläufig, und vielleicht ist es auch zu viel verlangt, sich die wenigen erklärenden Zeilen meines Konzeptes durchzulesen, um zu einem Verständnis zu kommen.
Es war ein hitziger Sommer voller kunsttheoretischer Diskussionen, neben der Blätterhäkelei, selbst mein Bildhauer stellte alles in Frage, Farbe, Form, Aussage – obwohl: das Konzept ließ er gelten. Auch die Freundschaft mit Ch. und die Auseinandersetzung mit seiner Kunst, die mich an einer Stelle meines Herzens, an der verwüsteten, sehr berührt, brachten mir unschätzbare Einsichten. Warum arbeiten wir, wieso möchten wir etwas zeigen, dessen Fertigung doch bereits das Ergebnis (die Kunst) ist, nicht das Zurschaustellen. Was macht die Arbeit wertvoll für mich (allein). Muss sie wertvoll für andere sein, oder möchten die vermeintlich Kunstinteressierten doch bloß wein- und sekttrinkend dabei sein und gesehen werden? Schaut man Fotos von Vernissagen an, sieht man die Honoratioren der Stadt/des Landes/des Flusses und nur manchmal einen Zipfel der Kunst dahinter.

Das alles soll mich nicht betrüben. Aus einem Reisebericht über den Hümmling um 1800, zitiert im Museumsführer des Museumsdorfes Cloppenburg: Die Wolle ist nicht sehr fein, aber lang und sehr brauchbar. Sie hat nun hinwiederum die Einwohner zum Spinnen und Stricken gereizt. Alle Hände, fast ohne Ausnahme, sind damit beschäftigt. Die Weiber jedoch mehr mit ersterem, die Männer und Kinder mit letzterem. Bauer und Bäuerin, Knecht und Magd, die Kinder vom fünften Jahr an – alles spinnt und strickt bis zum Grabe. So wie die Acker- und Hausarbeit einen freien Ausblick gewährt, gleich wird nach der Spindel, nach der Nadel gegriffen …“
Aus dieser Tradition erwächst meine Schaffensfreude. Notfalls stricke ich Socken für meine Freunde.
akrabke | 07. Oktober 2018, 11:19 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: Auf Reisen

Wir waren auf Wangerooge, der Bildhauer und ich. Seine Schwester S. arbeitet dort für zwei Wochen in der Gemeinde, um sie wieder auf Vordermann zu bringen, physisch mit Fensterputzen und so, und auch spirituell, durch ein paar gute Ideen, wie man die Menschen erreichen kann. Die Diakonin schickt ihr ab und zu unverständliche SMSse, weil sie sich mit dem Pfarrer gezankt hat, und es gibt ein großes Bullauge im Gemeindehaus, das auf keinen Fall im Sonnenschein geputzt werden darf wegen der Schlieren.
Sonst denken wir nicht viel. Das Meer ist schön und die Luft auch. Es gibt viel Sand. Wir erfahren vom Betreiber des Radverleihes, dass alle Nordseeinseln eigentlich wegwehen würden, wenn man sie nicht befestigte. Fortan betrachte ich jede Welle argwöhnisch, damit sie uns nicht zu viel des Sandes fortschwemme. Wenn ich allerdings Gott wäre, würde ich das so lassen. Der Radverleiher hat anscheinend einen Vortrag, den er ungefragt jedem Gast abspult, Sturmflut von 1961 und so, dazu tippt er auf eine kleine Landkarte. An der Stelle im Westen ist das Papier schon durchgerauht und schmutzig. Davon hätte ich gern ein Foto, aber die neue Kamera steckt in ihrer Tasche.
Eine Olympus habe ich erworben, die so retro aussieht, dass man ihr die Funktionen nicht glaubt, von denen ich mir noch keine Anwendung vorstellen kann. Die Busenfreundin, die ihre Riesen-Profi-Canon kaum hochheben kann, kommentierte das Gebilde: mit so einer Kamera brauchst du beim Fotoshooting gar nicht erst aufzutauchen. Ich gehe ja auch nicht zum Fotoshooting, sondern will Fotos machen. Dass ich mich für ein Foto-Stipendium beworben habe, verschweige ich ihr.
In Wangerooge tackeln die Rollkoffer auf dem schiefen Backsteinpflaster. Heutzutage reist wohl niemand mehr mit Rucksack wohin. Unser Domizil ist nett, ein bisschen wie zuhause mit Kissen und so, aber von der Inhaberin bekommen wir mehrere Rüffel, weil wir z. B. die Fahrräder falsch abstellen oder uns an den Vierertisch setzen wollen, obwohl wir bloß zu zweit sind. Am dritten Morgen, dem letzten, wache ich um fünf auf, weil ich Angst vor dem Frühstück habe, es ist wohl ausschließlich von Lidl, das ertrage ich nicht ein weiteres Mal. Ich wecke den Bildhauer, und kurz danach sind wir schon am Strand. Der beste Teil unseres Ausfluges. Ich mache ein paar Aufnahmen mit der Kamera, die ich vielleicht deshalb gekauft habe, weil sie Mark II als Namenszusatz hat – Mark Twain.

Man baut auch wieder Strandburgen, oder immer noch. Manche wirken wie Festungen aus Beton, auch die Fahnen fehlen nicht, und der Bildhauer schreibt FICKEN in die glattgeklopfte Wand der einen. Er muss immer ein bisschen revoltieren und läuft dazu in schwarzen Klamotten rum, aber er ist viel zu lieb und dann lache ich. Der Bäcker macht um sechs auf und dort sitzen wir lange und genießen richtigen Cappu und dreieckige Laugenbrötchen, deren Belag wir uns ausdenken konnten, u. a. mit Mayo. Sanddorn-Yoghurt-Schnitte danach. Noch so einen Kaffee.
An der Westseite gibt es einen Turm, dessen Dach ich zu spitz finde. Dort ist eine Jugendherberge untergebracht, und ich bin beeindruckt von den abgelatschten Stufen, die wir aufsteigen nach oben in das kleine Fensterzimmerchen. Blick auf Watt, Sand und Bewuchs. In der Ferne das Festland und die anderen Inseln. Spiekeroog. Wir tun die ganze Zeit so, als wären wir auf Baltrum, das finden wir ziemlich lustig.
akrabke | 19. Juli 2018, 23:21 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: Wiederholungen
Der Mutter schräg gegenüber am Tisch im Tagesraum sitzt eine weißhaarige Dame. Sie schaut stets etwas beiseite, und so dachte ich anfangs sie wäre blind. Tatsächlich nimmt sie jede vorbeigehende Person wahr, auch wenn sie sie nicht direkt anschaut, und fragt, wie immer — wie jede, alles gut? Und wie immer antworte ich großzügig, so als hätte ich die Welt in den Händen, ja klar, alles gut! Wenn es die Umstände erlauben, füge ich noch einen Grund des Gutseins hinzu, das schöne Wetter z. B..
Wie sehr ich mir wünsche, dass einmal mir jemand versicherte, alles sei gut.
Alles.
Ich müsste mich um nichts sorgen.
Wie sehr ich mir wünsche, dass einmal mir jemand versicherte, alles sei gut.
Alles.
Ich müsste mich um nichts sorgen.
akrabke | 02. Juli 2018, 15:54 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: Arbeitstisch
In Hörweite gibt es eine Amsel, die die ersten vier Töne von Whole Lotta Love singt, rhytmisch astrein, den fünften variiert sie – mal zieht sie ihn in die Länge, mal kommt er tirilierend, dann wieder so schräg, als hätte sie sich in der Skala vertan. Oft sitzt sie wohl auf dem Schornstein und dann höre ich ihre Melodie, durch Kamin und Badezimmer noch verstärkt, in allen Räumen und freue mich, und wundere mich immer wieder, auf welche Weise so kleine Vogelkörper derart durchdringende Stimmen erzeugen.
Anderes Schönes entfaltet sich ebenso. Der Bildhauer und ich nehmen jetzt definitiv an einer Ausstellung teil, die im Herbst im berühmten Garten der Stadt ausgetragen wird. Ein Studienfreund des Bildhauers bildet mit einer imaginären Geschichtsalternative, die sich nach 1945 zugetragen haben könnte, die Erzählung, innerhalb derer wir unsere Objekte ansiedeln. Plötzlich bekommen die Flugskizzen des Bildhauers eine stimmige Heimat und auch meine 1:4-Objekte erfahren eine Sinnhaftigkeit, als hätte ich seit einem halben Jahr allein darauf hingearbeitet. Meine Wohnung ist voll von Knäueln und Bündeln verschiedener Garne und Schnüre, die meine gesamte Vorstellungskraft wecken, wie Farben und Texturen zusammenkommen, wie Kleidung und Knöpfe, Haare und Mützen die Persönlichkeiten meiner Objekte bilden.
Es ist eine Zeit großer Gestaltungskraft – ich hätte nicht gedacht, dass das möglich sei. Erhellend auch die ausdauernden Gespräche darüber, was Kunst sei, wer Künstler, und wasgute schlechte interessante Kunst ausmacht. Wir wollen eine Geschichte erzählen und bieten eine Art Raum, der unsere Objekte enthält, die außerhalb dieses Geschehens eine gänzlich andere Berechtigung haben. Auf diese Weise müssen sie nicht einzeln erklärt werden, sondern bestimmen sich von selbst durch die sie umgebende Erzählung.
Über alldem liegt die große Trauer über die Mutter und ihren langsamen Abschied aus dieser Welt. Ich folge ihr nicht mehr – das zu versuchen, hat mich Kraft gekostet. Wie sich sich im Innern fühlt und was sie denkt, in welchen Welten sie sich aufhält, bleibt mir verschlossen. Sie wirkt ruhig, und sie spricht nicht mehr viel. Sie sucht nach Worten und gibt schnell auf, ich stelle es mir vor als eine Art Aufleuchten des Wunsches etwas Bestimmtes zu sagen, aber das Leuchten verschwindet, bevor die Idee reif ist, und bald auch der Wunsch und dann ist wieder Ruhe. Es ist wichtig, darüber nicht in Verzeiflung zu versinken. Jede Unsicherheit meinerseits bedeutet der Mutter, dass etwas nicht in Ordnung sei, außer Kontrolle geraten. Mit dem, was ich von den spirituellen Traditionen gelernt habe, versuche ich wenigstens für mich, Ordnung, Verständnis, Güte und was weiß ich noch zu gewinnen.
Das geht ganz gut.
Anderes Schönes entfaltet sich ebenso. Der Bildhauer und ich nehmen jetzt definitiv an einer Ausstellung teil, die im Herbst im berühmten Garten der Stadt ausgetragen wird. Ein Studienfreund des Bildhauers bildet mit einer imaginären Geschichtsalternative, die sich nach 1945 zugetragen haben könnte, die Erzählung, innerhalb derer wir unsere Objekte ansiedeln. Plötzlich bekommen die Flugskizzen des Bildhauers eine stimmige Heimat und auch meine 1:4-Objekte erfahren eine Sinnhaftigkeit, als hätte ich seit einem halben Jahr allein darauf hingearbeitet. Meine Wohnung ist voll von Knäueln und Bündeln verschiedener Garne und Schnüre, die meine gesamte Vorstellungskraft wecken, wie Farben und Texturen zusammenkommen, wie Kleidung und Knöpfe, Haare und Mützen die Persönlichkeiten meiner Objekte bilden.
Es ist eine Zeit großer Gestaltungskraft – ich hätte nicht gedacht, dass das möglich sei. Erhellend auch die ausdauernden Gespräche darüber, was Kunst sei, wer Künstler, und was
Über alldem liegt die große Trauer über die Mutter und ihren langsamen Abschied aus dieser Welt. Ich folge ihr nicht mehr – das zu versuchen, hat mich Kraft gekostet. Wie sich sich im Innern fühlt und was sie denkt, in welchen Welten sie sich aufhält, bleibt mir verschlossen. Sie wirkt ruhig, und sie spricht nicht mehr viel. Sie sucht nach Worten und gibt schnell auf, ich stelle es mir vor als eine Art Aufleuchten des Wunsches etwas Bestimmtes zu sagen, aber das Leuchten verschwindet, bevor die Idee reif ist, und bald auch der Wunsch und dann ist wieder Ruhe. Es ist wichtig, darüber nicht in Verzeiflung zu versinken. Jede Unsicherheit meinerseits bedeutet der Mutter, dass etwas nicht in Ordnung sei, außer Kontrolle geraten. Mit dem, was ich von den spirituellen Traditionen gelernt habe, versuche ich wenigstens für mich, Ordnung, Verständnis, Güte und was weiß ich noch zu gewinnen.
Das geht ganz gut.
akrabke | 26. Juni 2018, 12:44 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: Arbeitstisch
Manchmal gönne ich mir einen Besuch bei dem Mütterchen, bei dem ich keine besondere Rolle spiele. Weder die der tröstenden oder zurechtweisenden, noch die der traurigen Tochter oder der nach einem aufmunternden Gespräch suchenden. Dann gehe ich zur Gartengruppe ins Heim. Eine der Betreuerinnen, Mama nennt sie Lehrerin, hat im hinteren Teil des Grundstücks einen Garten angelegt, mit kleinen Wegen und einer Sitzgruppe inmitten von bereits üppig wachsenden und blühenden Pflanzen, in Erdreich und Hochbeeten, in Töpfen und Kästen. Auch gibt es einen kleinen Brunnen, der niedlich plätschert, sobald die Sonne scheint, denn er läuft auf Solar. Sogar das Mütterchen weißt das mit dem Solar.
Die sechseckigen Hochbeete sind praktisch. Man kann mit dem Rollstuhl ranfahren, sitzend die Arbeit verrichten und sich mit den Ellenbogen auf dem Rand abstützen. Ich bleibe im Hintergrund und beobachte, wie Mama mit kleinen Bewegungen der Anleitung folgt, die Erde aufzulockern und frische glattzuharken. Sie hält die Handharke fest, die Linke streicht ebenfalls über die Krumen, sie wirkt dabei konzentriert und lebendiger als sonst.
Ich sehe ihre Schultern und ihre weißen, dichten Haare, die sie recht lang und ungebändigt trägt, – und ein Gefühl von Geborgenheit kommt über mich: Da ist meine Mutter, die im Garten herumgräbt und ich bin wieder ihre Tochter, die sie sorglos beobachten darf, nachher geht sie bestimmt ins Haus und kommt mit einer Limonade oder einem Kräutertee zurück, und dann sitzen wir rum und schauen auf das Geschaffene.
Nachdem die Erde bereit ist, sät die Lehrerin Möhren, Radieschen, Pflücksalat und Gurken aus. Gestern, nach fünf Tagen, sieht man schon die ersten Sprießlinge.
Die sechseckigen Hochbeete sind praktisch. Man kann mit dem Rollstuhl ranfahren, sitzend die Arbeit verrichten und sich mit den Ellenbogen auf dem Rand abstützen. Ich bleibe im Hintergrund und beobachte, wie Mama mit kleinen Bewegungen der Anleitung folgt, die Erde aufzulockern und frische glattzuharken. Sie hält die Handharke fest, die Linke streicht ebenfalls über die Krumen, sie wirkt dabei konzentriert und lebendiger als sonst.
Ich sehe ihre Schultern und ihre weißen, dichten Haare, die sie recht lang und ungebändigt trägt, – und ein Gefühl von Geborgenheit kommt über mich: Da ist meine Mutter, die im Garten herumgräbt und ich bin wieder ihre Tochter, die sie sorglos beobachten darf, nachher geht sie bestimmt ins Haus und kommt mit einer Limonade oder einem Kräutertee zurück, und dann sitzen wir rum und schauen auf das Geschaffene.
Nachdem die Erde bereit ist, sät die Lehrerin Möhren, Radieschen, Pflücksalat und Gurken aus. Gestern, nach fünf Tagen, sieht man schon die ersten Sprießlinge.
akrabke | 29. Mai 2018, 11:48 | 0 Kommentare
| Kommentieren