Topic: Arbeitstisch
Ich bin jetzt mehr oder weniger entschlossen, das Jahr 2017 freizumachen, ich will es jetzt nicht großartig sabbatical nennen, und natürlich könnte man behaupten, ich hätte schon letzten Herbst damit angefangen. Ein bisschen. Vor ein paar Tagen habe ich nach neuen Jobs geschaut, und auch etwas gefunden, das ich immerhin so interessant fand, um eine Bewerbung zu erwägen. Gestern aber ist die kleine Mutter durchgedreht, sie war so wütend auf alles und jeden und schimpfte und schlug um sich. Ich war ein paar Stunden bei ihr, um sie zu beruhigen und mit ihr zu reden, es wurde eine echte Standpauke über Mitgefühl und Freundlichkeit, und sie jammerte, das kann ich nicht, das kann ich nicht, heute morgen musste ich schon drüber lachen. Gestern aber war ich mit den Nerven fertig und dachte, wie soll ich bei all den Ablenkungen arbeiten? An was denn überhaupt, was wichtiger ist als dies: Im Frieden mit sich und den Menschen sein, mit der Vergangenheit und den Feinheiten der aufsteigenden samskaras, herausfinden, was ich wirklich tun möchte in dieser aufregenden Welt. Stefan Sagmeister, der große Grafik-Designer, den ich bis jetzt gar nicht so ausführlich kannte, ist mit seinem Film in aller Munde und hat auch ein Jahr nicht gearbeitet. Letztlich hat er doch gearbeitet, aber eben für sich, das musste ich jetzt mal kursiv setzen, der hat das auch gemacht – als würde ein Kleinkind sprechen.
Tatsächlich, es gibt immer noch diesen kindlichen Rechtfertigungszwang, da hinten in der Ecke des Geistes, auf jeden Fall was tun müssen, produktiv sein. Verflixt. Und vielleicht bin ich auch keine so große Designerin, der eine Schaffenspause gebührt.
Aber vielleicht sollte ich einfach mal die Klappe halten und machen.
Am besten gleich alles kursiv.
Tatsächlich, es gibt immer noch diesen kindlichen Rechtfertigungszwang, da hinten in der Ecke des Geistes, auf jeden Fall was tun müssen, produktiv sein. Verflixt. Und vielleicht bin ich auch keine so große Designerin, der eine Schaffenspause gebührt.
Aber vielleicht sollte ich einfach mal die Klappe halten und machen.
Am besten gleich alles kursiv.
akrabke | 05. Januar 2017, 16:05 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: Leben ist Leiden, haha
"Ich weiß manchmal nicht mehr, wie viele Kinder ich eigentlich habe", sagt sie. Bei sowas zerspringt mir fast jedesmal das Herz. Na, sage ich, zwei Töchter – Dudi und mich. Noch immer lege ich jedes ihrer Worte auf die Goldwaage, und für mich ist sie beides, meine Mama und gleichzeitig eine völlig unbekannte Frau, die wirr vor sich hinredet. Ich suche nach Wahrem, zwischendrin, das hört nicht auf. Bist du traurig, wenn ich sterbe, fragt sie und schaut ein bisschen an mir vorbei, obwohl ich ihr beinah in der Nase sitze, um sie ganz nah zu haben.
Swami sagt, es gäbe keine dementen Yogis, als ich ihm meine Befürchtungen mitteile, die Krankheit erben zu können. Manchmal fallen mir Wörter nicht ein. Mir auch nicht, lacht er. Als visueller Mensch habe ich aber neben dem Abbild des Objektes das Schriftbild eines Wortes vor Augen, so lese ich es zur Not einfach ab. Trick 17.
In der letzten Zeit haben die Buddhistin und ich oft anstrengende Diskussionen, die sich wie kurz vor Streit anfühlen. Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Wir versuchen einander noble Freunde zu sein, mit jederzeit abrufbaren philosophischen Empfehlungen für alle Notfälle, deren es genug gibt: meine kleine Mutter, ihre 20 Jahre jüngere Geliebte etc., da ich aber dem Vedantischen fröhne und sie dem Buddhistischen anhängt, gibt es weltanschauliche gaps. Mir ist aufgefallen, dass mich der Buddhismus mit Leben ist Leiden auf Dauer echt runterzieht. Jaja, ich weiß doch, Vergänglichkeit ist unschön, und jeder Wunsch zieht weitere Wünsche nach sich, und am Ende springt man irgendwo runter, damit das Ganze aufhören möge. Oder man beginnt zu meditieren und dann weiß man noch genauer, wie unschön eigentlich. Vedanta und Co. hingegen scheinen mir aus dem Schönen zu sprechen, vom Schönen, man ist sozusagen schon in Sicherheit und kann halbwegs gelassen auf das Leid schauen. Das genau scheint mir der Punkt in unseren verzweifelten Disputen zu sein, die Buddhistin erlaubt sich das Gelassensein (noch) nicht, während ich es schon bin. Jedenfalls des öfteren. Was ich mir aber nicht traue zu sagen, um ihr Leid nicht zu schmälern, oder ihr Ego – welches das Leid erst macht. Und so weiter. Das ist alles intellektuelle Kacke, während wir so reden, werden da Ebenen vermischt, die nicht zusammen gehen, und das erkennen wir im Gefecht nicht, erst hinterher liege ich die halbe Nacht wach und versuche, das Knäuel zu lösen; bin viel zu nah dran. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht mehr drauf einzulassen, ich werde ihr weiterhin zuhören, die noble Freundin bleiben, aber meinen Kram behalte ich für mich. Es wäre am schönsten, wenn ich einfach gar keine Meinung mehr haben müsste. So direkt zur Synthese leiten, und dann nach mir die Sinntflut.
Swami sagt, es gäbe keine dementen Yogis, als ich ihm meine Befürchtungen mitteile, die Krankheit erben zu können. Manchmal fallen mir Wörter nicht ein. Mir auch nicht, lacht er. Als visueller Mensch habe ich aber neben dem Abbild des Objektes das Schriftbild eines Wortes vor Augen, so lese ich es zur Not einfach ab. Trick 17.
In der letzten Zeit haben die Buddhistin und ich oft anstrengende Diskussionen, die sich wie kurz vor Streit anfühlen. Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Wir versuchen einander noble Freunde zu sein, mit jederzeit abrufbaren philosophischen Empfehlungen für alle Notfälle, deren es genug gibt: meine kleine Mutter, ihre 20 Jahre jüngere Geliebte etc., da ich aber dem Vedantischen fröhne und sie dem Buddhistischen anhängt, gibt es weltanschauliche gaps. Mir ist aufgefallen, dass mich der Buddhismus mit Leben ist Leiden auf Dauer echt runterzieht. Jaja, ich weiß doch, Vergänglichkeit ist unschön, und jeder Wunsch zieht weitere Wünsche nach sich, und am Ende springt man irgendwo runter, damit das Ganze aufhören möge. Oder man beginnt zu meditieren und dann weiß man noch genauer, wie unschön eigentlich. Vedanta und Co. hingegen scheinen mir aus dem Schönen zu sprechen, vom Schönen, man ist sozusagen schon in Sicherheit und kann halbwegs gelassen auf das Leid schauen. Das genau scheint mir der Punkt in unseren verzweifelten Disputen zu sein, die Buddhistin erlaubt sich das Gelassensein (noch) nicht, während ich es schon bin. Jedenfalls des öfteren. Was ich mir aber nicht traue zu sagen, um ihr Leid nicht zu schmälern, oder ihr Ego – welches das Leid erst macht. Und so weiter. Das ist alles intellektuelle Kacke, während wir so reden, werden da Ebenen vermischt, die nicht zusammen gehen, und das erkennen wir im Gefecht nicht, erst hinterher liege ich die halbe Nacht wach und versuche, das Knäuel zu lösen; bin viel zu nah dran. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht mehr drauf einzulassen, ich werde ihr weiterhin zuhören, die noble Freundin bleiben, aber meinen Kram behalte ich für mich. Es wäre am schönsten, wenn ich einfach gar keine Meinung mehr haben müsste. So direkt zur Synthese leiten, und dann nach mir die Sinntflut.
akrabke | 19. November 2016, 17:58 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: Einsatz
Das erste Mal seit langer Zeit kränklich, lustlos, halsschmerzend und langsam im Kopf. Auf einer 40jahr-Firmenfeier am Samstag wurde sich über Burnout ausgetauscht, vielleicht wäre das auch eine Option für mich. Eine ereignislose Kur fernab von telefonischer Bereitschaft, und etwas Geld ohne zu arbeiten. Das ohne zu arbeiten praktiziere ich auch so, das bedeutet natürlich auch keine Einkünfte. Den fehlenden Geldzuwachs könnte man durch den Verkauf des Elternhauses abfedern, wenn der denn genehmigt würde. Die Betreuerin, die das Gericht als Bevollmächtigte der Mutter bestimmte, empfinde ich als voller Vorwürfe gegen mich. Es sei nicht rechtens gewesen, das Sparguthaben meines Vaters durch drei zu teilen, ob die Mutter denn auf ihre Hälfte verzichtet hätte? Erst später wird mir klar, dass man einfach davon ausgeht, dass die Mutter vor sechs Jahren schon dement war. In einem langen Brief berichte ich der Betreuerin und dem Gericht von dem, was ich beim Vorsprechen aus Stress unfähig war zu sagen. Vor Gericht also, verdammt! Ob diese Schuldgefühle irgendwann endlich aufhören? Das beste an dieser Auseinandersetzung ist, dass ich mir selbst klar werde, was für eine Menge Gutes ich für die Mutter getan und geregelt habe. Vielleicht wird das die Schuldgefühle vertreiben können. Wir werden das Haus außerdem nicht für einen Preis verkaufen dürfen, sagt die Betreuerin, der um so viele Tausend unter dem Gutachten liegt. Ich würde sie als Rockerbraut bezeichnen, optisch, und wenig empatisch, ob Rechtanwältinnen darin auch geschult werden? Jedenfalls bringt sie mich zum Weinen und wahrscheinlich hält sie meine Tränen für falsch, ein weiterer Grund, unfreundlich zu mir zu sein.
In der Nacht träume ich von einem metergroßen mumifizierten Embryo mit schwarzen Augenhöhlen, den ich aus dem matschigen Grund ziehe, zusammen mit anderen Hindernissen, die unserem holzberäderten Wagen im Weg liegen. Sehr ekelig, doch später sehe ich das Kind, das in diesem sich als Film entpuppenden Szenario mitmacht, auf der Wiese spielen, selbstvergessen und fröhlich, mit dickem schwarzen Kurzhaar, zu früh seine Mumienrolle vergessend, obwohl die Kamera noch läuft. Wir lachen und werden das nochmal drehen müssen. Ein in der Nachschau poetischer Traum mit guten Zeichen, aber trotzdem erst noch ein bisschen krank sein und jammern. Nachher rufe ich Dudi an, die soll mich trösten, die kleine Mutter selbst braucht eigenen Trost, auch das ein Grund zum Weinen, ich habe keine Mama mehr die mich trösten kann, rufe ich dem Bildhauer zu, nicht ohne gespielte Dramatik, die er mir natürlich verzeiht. Er vermag nicht so viel tun, außer die Stimmung mit ein paar Niedlichkeiten zu wenden und mich zum Lachen zu bringen.
Wie gehen wir vor. Ich weiß es nicht. Ich lese viel – in den alten Schriften des Vedanta, mache weiter mit der großen Mantraübung, vertiefe mein Englisch anhand Phil Collins’ Biografie, schaue Filme, die mir gut tun und denke mir Kunst aus, oder Design oder wie man das nennt. Es ist trotz des Gefühls von Stillstand eine kreative und äußerst erkenntnisreiche Zeit. Die Mutter hat möglicherweise die letzten 50 Jahre vergessen, auch auf den alten Fotos kein Erkennen des hinfortgewünschten Hauses, eine kleine Erinnerung nur an die Wickenhecke, von der Besucher je ein Sträußchen mitbekamen, das ist aber auch schon fast die gleiche Zeit her. Aber sie berichtet lebhaft von Alltäglichkeiten im Heim, die ihre gesamte Aufmerksamkeit einnehmen. Fast jedes Mal erzähle ich ihr von der Hüft-OP und warum sie nicht mehr gehen kann, was sie jedes Mal erstaunt quittiert und – wahrscheinlich sofort wieder vergisst. Es gibt aber auch viel zu lachen, über Schabernack, mit niedlich gefälteltem Mund vorgetragen, und kleinen Frechheiten. Stets freut sie sich über die mitgebrachten Blumen oder eine Süßigkeit – ihr Leben ist sehr einfach geworden. Mich animiert das wiederum ebenso zu Simplifizierungen meines lifes, hinfort auch alles zu Komplizierte. Ich sollte nun endlich auch anfangen, die letzten 50 Jahre zu vergessen. Das würde mir gut tun.
In der Nacht träume ich von einem metergroßen mumifizierten Embryo mit schwarzen Augenhöhlen, den ich aus dem matschigen Grund ziehe, zusammen mit anderen Hindernissen, die unserem holzberäderten Wagen im Weg liegen. Sehr ekelig, doch später sehe ich das Kind, das in diesem sich als Film entpuppenden Szenario mitmacht, auf der Wiese spielen, selbstvergessen und fröhlich, mit dickem schwarzen Kurzhaar, zu früh seine Mumienrolle vergessend, obwohl die Kamera noch läuft. Wir lachen und werden das nochmal drehen müssen. Ein in der Nachschau poetischer Traum mit guten Zeichen, aber trotzdem erst noch ein bisschen krank sein und jammern. Nachher rufe ich Dudi an, die soll mich trösten, die kleine Mutter selbst braucht eigenen Trost, auch das ein Grund zum Weinen, ich habe keine Mama mehr die mich trösten kann, rufe ich dem Bildhauer zu, nicht ohne gespielte Dramatik, die er mir natürlich verzeiht. Er vermag nicht so viel tun, außer die Stimmung mit ein paar Niedlichkeiten zu wenden und mich zum Lachen zu bringen.
Wie gehen wir vor. Ich weiß es nicht. Ich lese viel – in den alten Schriften des Vedanta, mache weiter mit der großen Mantraübung, vertiefe mein Englisch anhand Phil Collins’ Biografie, schaue Filme, die mir gut tun und denke mir Kunst aus, oder Design oder wie man das nennt. Es ist trotz des Gefühls von Stillstand eine kreative und äußerst erkenntnisreiche Zeit. Die Mutter hat möglicherweise die letzten 50 Jahre vergessen, auch auf den alten Fotos kein Erkennen des hinfortgewünschten Hauses, eine kleine Erinnerung nur an die Wickenhecke, von der Besucher je ein Sträußchen mitbekamen, das ist aber auch schon fast die gleiche Zeit her. Aber sie berichtet lebhaft von Alltäglichkeiten im Heim, die ihre gesamte Aufmerksamkeit einnehmen. Fast jedes Mal erzähle ich ihr von der Hüft-OP und warum sie nicht mehr gehen kann, was sie jedes Mal erstaunt quittiert und – wahrscheinlich sofort wieder vergisst. Es gibt aber auch viel zu lachen, über Schabernack, mit niedlich gefälteltem Mund vorgetragen, und kleinen Frechheiten. Stets freut sie sich über die mitgebrachten Blumen oder eine Süßigkeit – ihr Leben ist sehr einfach geworden. Mich animiert das wiederum ebenso zu Simplifizierungen meines lifes, hinfort auch alles zu Komplizierte. Ich sollte nun endlich auch anfangen, die letzten 50 Jahre zu vergessen. Das würde mir gut tun.
Topic: Leben ist Leiden
Und weil die Buddhistin und ich überhaupt nicht im Training sind, fühlen wir uns nach je eineinhalb Gläsern feinstem Rotwein aus Portugal als hätten wir ordentlich einen im Kahn. Sie hat ihr Fernstudium mit 2 abgeschlossen, ein Anlass zur Freude, und auch zum Grundsatzcheck des Geistes, der ja immer so mitläuft, als wäre er ebenfalls besoffen. Wir haben viel zu reden, am schönsten sind die Phasen, in denen wir uns mit unseren Eltern versöhnt fühlen. Ich erzähle von der kleinen Mutter, wie immer mit großer Rührung, wir kramen unserer Mütter Erinnerungen aus, wie jung sie waren, und wie toll die Kerle, mit denen sie irgendwie gezwungenermaßen eine Familie gegründet haben. Der Wein macht, dass wir ihre Beweggründe er- äh, gründen, und wir halten unsere Hände und postulieren, dass man sich auch liebhaben kann, ohne sich sexuell zu vereinen und so weiter, es ist alles so ganz wunderbar und so muss es auch nach dem zweiten gut eingegossenen Getränk sein, wir kommen doch wohl je auf 350 ml, was ja zusammen schon fast eine ganze Flasche macht und so, und morgen trinken wir zum Frühstück je zwei Ramazotti, was wir noch nie gemacht haben, weil wir je zwei schwierige Gespräche vor uns haben, ich über das Ende meiner diakonischen Beziehung und sie über zu leistende Wochenstunden. Ich habe mit den Teilnehmerinnen ein verdammt cooles Alphabet, auch genannt Font, aus Kartoffeln zusammengeschnitzt, jeder sollte übrigens ein eigenes Alphabet haben, vielleicht eines aus den Gesten des Lehrers der Buddhistin und nicht bloß aus Kartoffeln, das wären dann die höheren Weihen.
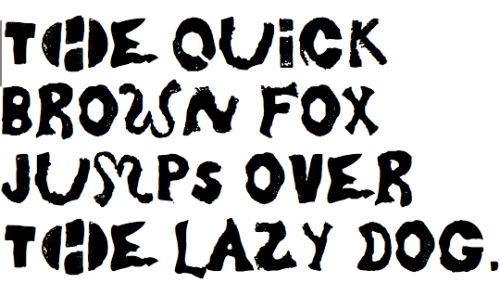
Wo auch sonst rüber?
Morgen werde ich die kleine Mutter nach Papa ausfragen und wie sie sich kennengelernt haben, vielleicht erinnert sie sich ja noch. Jegliche Konzepte von Ehe und so sind ihr schon in Vergessenheit geraten und mit der Buddhistin bewundere ich die Schönheit der sogenannten Krankheit Demenz. Ganz im Hier und Jetzt, das wollen wir doch alle, oder?
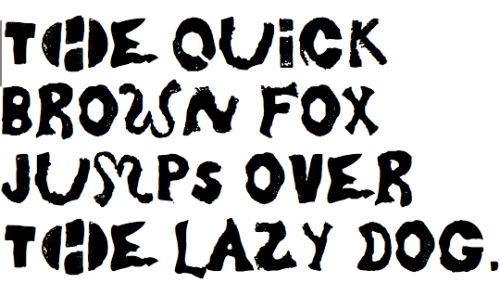
Wo auch sonst rüber?
Morgen werde ich die kleine Mutter nach Papa ausfragen und wie sie sich kennengelernt haben, vielleicht erinnert sie sich ja noch. Jegliche Konzepte von Ehe und so sind ihr schon in Vergessenheit geraten und mit der Buddhistin bewundere ich die Schönheit der sogenannten Krankheit Demenz. Ganz im Hier und Jetzt, das wollen wir doch alle, oder?
akrabke | 15. Juli 2016, 02:00 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: oh Jugend
Natürlich das innere Wetter: Langsam legt sich der Sturm, der ein Versuch ist, eine Entscheidung zu treffen. Hat mich angestrengt, das letzte Jahr. Nicht nur die Mutter, die ins Vergessen lebt – da waren auch die Auszubildenden, die mir ans Herz wuchsen und die doch nicht fähig waren, sich auf ihr Ziel zu konzentrieren. Einblicke in fremde Leben erhalten, tiefer als mir guttut. Einblicke auch zurück in Eigenes, Tiefes. Ist doch schön, wenn die jungen Menschen dir folgen, wenn du sie motivieren kannst. So als läge alles in der eigenen Macht. Meditationen darüber bringen zutage, dass es versteckten Missbrauch gibt, der läuft als Grundtton stets mit: Gute Gefühle sich von den anderen holen, den vermeintlich Bildungsfernen, über denen wir stehen. Ich kommuniziere aber gern auf gleicher Höhe und wenn mir das gelingt, gefällt es allen am besten. Wie mich die Pädagogik-Sprech schon nach kürzester Zeit nervte. Wie ich mit der Buddhistin einen Arbeitsplatz innehabe und sich aus den Diskussionen über die Sinnhaftigkeit dieses Jobs die viel größere Frage ergibt – nämlich nach dem Sinn des Lebens überhaupt.
Es steht noch das Gespräch an, in dem ich erkläre, dass ich das (ohnehin befristete) Anstellungsverhältnis nicht weiterführen möchte. Ich habe ein wenig Angst, dass man mich umstimmen könnte. In meinem Innern befindet sich eine endlose Liste der Pros und Contras dieses mittlerweile von mir Experiment genannten Unterfangens. Die Pros bestehen hauptsächlich aus Spaß haben oder gerne jemandem etwas beibringen, das ich gut kann, unter anderem natürlich auch, monatlich eine feste Summe Geldes zur Verfügung zu wissen. Das eine große Contra, das alle Pros überbügelt, ist: Ich möchte meine Ruhe haben! Wieder frei sein! Keine Sorgen um Lebensläufe, keine schlaflosen Nächte, keine begeisterten Unterrichtsvorbereitungen, die ins Leere laufen, weil niemand kommt. Drogen oder so, verschlafen, kein’ Bock, Magen- und sonstige Verstimmungen, ich weiß nicht, welche Ärzte die Frauen immer gleich krankschreiben, ohne mal nach Gründen zu fragen, das ist wirklich verantwortungslos. Eigentlich ist das ganze Konstrukt Berufsorientierung quatsch, wenn die Teilnehmerinnen eigentlich überhaupt nicht teilnehmen wollen, nicht am System, an der Gesellschaft, letzlich nicht mal am Leben. Ich schaue auf ihre geritzen Unterarme, und weil kein Platz mehr ist, wird oben weitergeritzt. Mein Blick folgt jedem einzelnen Strich, manche sind noch frisch und rot, wie von gestern Nacht. Das trifft dann wieder auf meine eigene Schlaflosigkeit und so sind wir alle bloß Teilnehmerinnen an diesem Projekt, man könte die Rollen auch tauschen, wir sind gegenseitig abhängig voneinander. Eine echte Scharade, ritzen, schauen, beurteilen, weinen, lachen, wichtigtun.
Also, viel gelernt würde ja als Argument reichen. Noch ein Danke hinterher, wen interessieren schon die Feinheiten meiner wochenlangen Grübeleien, oder gar die Kritik, die ich mich weigern würde zu äußern. Eventuell eine Art von ich kann eine qualitätsvolle Ausbildung mit den im Hause befindlichen Werkzeugen und Materialien nicht garantieren. Aller guten Absichten zum Trotz versackt jedes Bemühen, nicht nur meines, irgendwo. Ich kann nur hoffen, dass vielleicht ein winziger Impuls bei einer der Frauen Saat trägt, dass vielleicht ein anerkennender Blick oder Kommentar oder ein Lachen bemerkenswert genug war, ein Herz zu rühren, eine Wendung herbeizuführen, oder einen pädagogischen Wunsch zu erfüllen, denn beide Seiten sind ja voller Hoffnungen und Vorstellungen eines besseren Lebens. Dass dieses Leben dann eine Berufstätigkeit als Hauptziel haben soll, besprechen wir ein anderes Mal. Als gäbe es nichts sonst.
Es steht noch das Gespräch an, in dem ich erkläre, dass ich das (ohnehin befristete) Anstellungsverhältnis nicht weiterführen möchte. Ich habe ein wenig Angst, dass man mich umstimmen könnte. In meinem Innern befindet sich eine endlose Liste der Pros und Contras dieses mittlerweile von mir Experiment genannten Unterfangens. Die Pros bestehen hauptsächlich aus Spaß haben oder gerne jemandem etwas beibringen, das ich gut kann, unter anderem natürlich auch, monatlich eine feste Summe Geldes zur Verfügung zu wissen. Das eine große Contra, das alle Pros überbügelt, ist: Ich möchte meine Ruhe haben! Wieder frei sein! Keine Sorgen um Lebensläufe, keine schlaflosen Nächte, keine begeisterten Unterrichtsvorbereitungen, die ins Leere laufen, weil niemand kommt. Drogen oder so, verschlafen, kein’ Bock, Magen- und sonstige Verstimmungen, ich weiß nicht, welche Ärzte die Frauen immer gleich krankschreiben, ohne mal nach Gründen zu fragen, das ist wirklich verantwortungslos. Eigentlich ist das ganze Konstrukt Berufsorientierung quatsch, wenn die Teilnehmerinnen eigentlich überhaupt nicht teilnehmen wollen, nicht am System, an der Gesellschaft, letzlich nicht mal am Leben. Ich schaue auf ihre geritzen Unterarme, und weil kein Platz mehr ist, wird oben weitergeritzt. Mein Blick folgt jedem einzelnen Strich, manche sind noch frisch und rot, wie von gestern Nacht. Das trifft dann wieder auf meine eigene Schlaflosigkeit und so sind wir alle bloß Teilnehmerinnen an diesem Projekt, man könte die Rollen auch tauschen, wir sind gegenseitig abhängig voneinander. Eine echte Scharade, ritzen, schauen, beurteilen, weinen, lachen, wichtigtun.
Also, viel gelernt würde ja als Argument reichen. Noch ein Danke hinterher, wen interessieren schon die Feinheiten meiner wochenlangen Grübeleien, oder gar die Kritik, die ich mich weigern würde zu äußern. Eventuell eine Art von ich kann eine qualitätsvolle Ausbildung mit den im Hause befindlichen Werkzeugen und Materialien nicht garantieren. Aller guten Absichten zum Trotz versackt jedes Bemühen, nicht nur meines, irgendwo. Ich kann nur hoffen, dass vielleicht ein winziger Impuls bei einer der Frauen Saat trägt, dass vielleicht ein anerkennender Blick oder Kommentar oder ein Lachen bemerkenswert genug war, ein Herz zu rühren, eine Wendung herbeizuführen, oder einen pädagogischen Wunsch zu erfüllen, denn beide Seiten sind ja voller Hoffnungen und Vorstellungen eines besseren Lebens. Dass dieses Leben dann eine Berufstätigkeit als Hauptziel haben soll, besprechen wir ein anderes Mal. Als gäbe es nichts sonst.
akrabke | 12. Juli 2016, 21:06 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: gesehen

Dieses Bild soll den Beginn einer künstlerischen Zusammenarbeit mit dem Bildhauer kennzeichnen. Wir haben eine Idee, die (uns) nun schon seit Tagen trägt. Im September wird es eine Ausstellung geben. Wer weiß, was [von dieser Idee] übrig bleibt.
akrabke | 02. März 2016, 12:26 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: Arbeitstisch
Mal was Kleines schreiben, entgegen der großen Gefühle über Leben und Tod. Zum Frühstück selbstgebackene Haselnuss-Schoko-Plätzchen mit einem großen Getreidekaffee. Ein bisschen lesen, was die anderen machen, die Damen Montez und Wunderkarte, die Herren Kid und Schneck. Sich darüber freuen, dass der Computer so gut funktioniert und systemisch auf dem aktuellesten Stand. Ein bisschen arbeiten, die neuen Programme ausprobieren. Warten bis die Sonnenstrahlen am Bildschirm vorbei sind, dann fang ich an.
Stille.
Stille.
akrabke | 24. Februar 2016, 11:14 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Eine sonderbare Gefühllosigkeit hat mich erfasst, eher noch eine Abwesenheit von dramatischem Empfinden, vielleicht könnte man es auch schlicht Ruhe nennen (ich kenne mich da nicht mehr so aus). Es ist äußerst angenehm. Obschon die Angenehmheit ja auch wieder Gefühl ist. Vielleicht hatte ich das bloß lange nicht, nicht mal das Schwelen ist mehr da, das mich die letzten Monate oder Jahre begleitet hatte – von zu erwartendem Telefonklingeln incl. Katastrophennachrichten oder der Vorstellung von vergeigten Arbeitsbeziehungen 2015 (Web/SEO/arsch). Also, ich räume auf.
2015 war auch das Jahr der spirituellen Krise. Mein Lehrer, mein Swami hatte im Sommer seinen Körper verlassen. In so einer Facebook-Gruppe wurden Bilder seines aufgebahrten Körpers verbreitet. Wir im Westen sind ja nicht so vertraut mit dem Anblick von Toten und auch hier waren es nur Bilder. Und Filme. Am Ende großartigster Zeremonien wurde der Körper mit einem beinahe abfälligen Schubs im Ganges versenkt. Man sollte ja frohlocken, wenn ein Meister sein mahasamadhi erreicht, aber mir war sterbenstraurig zumute. Ich klickte mich durch das unerträgliche Bildmaterial und heulte vor mich hin.
Nun, Anfang Februar, beginnen die Vorsätze und die Pillen zu greifen. Die Ayurvedin hatte ich wieder aufgesucht, den seit Monaten (oder Jahren) schmerzenden Ischias wollte ich doch lieber von ihr behandeln lassen. Dabei gelernt, das das Gesundheitswesen in Deutschland nicht gesund machen kann. Vielleicht will es das auch gar nicht, wer weiß. Die mickrigen sieben mal 20 Minuten Physiotherapie wurden nur ungern auf zwölf aufgestockt und kaum hatte man sich halbwegs eingefunden und warmgelaufen, war die Behandlung schon vorbei. Später habe ich mir dann köstliche ayurvedische Massagen geben lassen mit viel Öl und den Körper mit Nährstoffen überflutet.
Bin jetzt auch im Bilde, wie das Sozialwesen funktioniert, oder dass es nicht funktioniert. Eine meiner beiden Azubis hat die Ausbildung abgebrochen, es ist wirklich ein Problem, wenn man eine Ausbildung derart nachgeschmissen bekommt und sich kein Stück dafür anstrengen musste. Na, dann fange ich doch was anderes an, wenn ich hierauf keinen Bock habe, das Amt wird schon zahlen. Die Buddhistin, mit der ich bei der Diakonie zusammenarbeite, schreibt ihren Bachelor darüber, dass underdogs vom System selbst als underdogs gehalten werden, und wie bedürftig die soziale Arbeit überhaupt ist.
Über/hinter/unter alldem die kleine Mutter. Nach Hüft-OP, leichtem Schlaganfall und einer bedrohlichen Magen- und Darmerkrankung vorletze Woche (Mama, wenn du nicht trinkst, bist du in drei Tagen tot – dass ich sowas mal zu jemandem sage – ) ist sie wieder obenauf, sie erzählt mir tausend Begebenheiten im Heim, die Karnevalfeier hätte ihr gefallen, sogar ein Hütchen hat sie aufbekommen. Ein Hütchen. Wir grinsen uns an. Ich bin heute wirklich überhaupt nicht besorgt. In den letzten fünf Jahren hatte ich mindestens 50 Mal gedacht, sie stirbt jetzt gleich, nun isses soweit, wahrscheinlich zermürbt das den Geist, der das Sterben als gefühlsbeladenes Bild schon tausendmal vorweggenommen hat, und irgendwann glaubt man nicht mehr an den Tod. Ganz einfach.
2015 war auch das Jahr der spirituellen Krise. Mein Lehrer, mein Swami hatte im Sommer seinen Körper verlassen. In so einer Facebook-Gruppe wurden Bilder seines aufgebahrten Körpers verbreitet. Wir im Westen sind ja nicht so vertraut mit dem Anblick von Toten und auch hier waren es nur Bilder. Und Filme. Am Ende großartigster Zeremonien wurde der Körper mit einem beinahe abfälligen Schubs im Ganges versenkt. Man sollte ja frohlocken, wenn ein Meister sein mahasamadhi erreicht, aber mir war sterbenstraurig zumute. Ich klickte mich durch das unerträgliche Bildmaterial und heulte vor mich hin.
Nun, Anfang Februar, beginnen die Vorsätze und die Pillen zu greifen. Die Ayurvedin hatte ich wieder aufgesucht, den seit Monaten (oder Jahren) schmerzenden Ischias wollte ich doch lieber von ihr behandeln lassen. Dabei gelernt, das das Gesundheitswesen in Deutschland nicht gesund machen kann. Vielleicht will es das auch gar nicht, wer weiß. Die mickrigen sieben mal 20 Minuten Physiotherapie wurden nur ungern auf zwölf aufgestockt und kaum hatte man sich halbwegs eingefunden und warmgelaufen, war die Behandlung schon vorbei. Später habe ich mir dann köstliche ayurvedische Massagen geben lassen mit viel Öl und den Körper mit Nährstoffen überflutet.
Bin jetzt auch im Bilde, wie das Sozialwesen funktioniert, oder dass es nicht funktioniert. Eine meiner beiden Azubis hat die Ausbildung abgebrochen, es ist wirklich ein Problem, wenn man eine Ausbildung derart nachgeschmissen bekommt und sich kein Stück dafür anstrengen musste. Na, dann fange ich doch was anderes an, wenn ich hierauf keinen Bock habe, das Amt wird schon zahlen. Die Buddhistin, mit der ich bei der Diakonie zusammenarbeite, schreibt ihren Bachelor darüber, dass underdogs vom System selbst als underdogs gehalten werden, und wie bedürftig die soziale Arbeit überhaupt ist.
Über/hinter/unter alldem die kleine Mutter. Nach Hüft-OP, leichtem Schlaganfall und einer bedrohlichen Magen- und Darmerkrankung vorletze Woche (Mama, wenn du nicht trinkst, bist du in drei Tagen tot – dass ich sowas mal zu jemandem sage – ) ist sie wieder obenauf, sie erzählt mir tausend Begebenheiten im Heim, die Karnevalfeier hätte ihr gefallen, sogar ein Hütchen hat sie aufbekommen. Ein Hütchen. Wir grinsen uns an. Ich bin heute wirklich überhaupt nicht besorgt. In den letzten fünf Jahren hatte ich mindestens 50 Mal gedacht, sie stirbt jetzt gleich, nun isses soweit, wahrscheinlich zermürbt das den Geist, der das Sterben als gefühlsbeladenes Bild schon tausendmal vorweggenommen hat, und irgendwann glaubt man nicht mehr an den Tod. Ganz einfach.
akrabke | 03. Februar 2016, 19:20 | 0 Kommentare
| Kommentieren
Topic: Nah
Nicht mal mein login weiß ich noch auswendig. So schwindet alles. Auch die Mutter. Was denn mit Papa sei, ob der mal vorbei käme? Der ist doch schon gestorben, sage ich letzte Woche freundlich. Und heute fragt sie nach Annemarie, meinst du deine Schwester, Mama, die ist lange tot, und deine anderen Geschwister auch. Aus einem verzweifelt verzerrten Mund ruft sie: das kann doch nicht sein! Ein bisschen weint sie. Ich versuche, ihr alles zu erklären. Ein update sozusagen. So als machte sie ab und zu ein paar Stippvisiten aus der Zeitlosigkeit in unser Kontinuum, in dem plötzlich nichts mehr stimmt. Dann, mit etwas schärferer Stimme: Was ist hier eigentlich los? Kannst du mir das mal erklären? Einen Moment falle ich drauf rein, und befürchte, dass sie wütend wird. Also noch mehr Geschichten aus dem damaligen Leben, denn sie befindet sich ich weiß nicht wo. Der hat doch ein kleines Haus gebaut. Ja, da habt ihr zusammen gelebt, da bin ich aufgewachsen. Ob sie schon einen frischen Körper in einem anderen Leben hat und hier noch ist, damit ich an ihrem Bett sitzen kann, oder mit ihr liegen kann und ihr Gesicht streicheln, ihre Hände massieren, ihr tausend mal sagen, wie süß sie ist, sie ist die allersüßeste Mama, die es verdammt nochmal überhaupt gibt.
Ich hätte gedacht, ein Sterben mitanzusehen, wäre schlimmer. Dass ich immer weinen müsste, so wie jetzt, weil ich schreibe. Wenn ich aber bei ihr bin, seit dem Schlaganfall jeden Tag, bin ich ganz ruhig und eine nicht geahnte Freude ist in mir und Kraft. Möglicherweise bin ich die einzige, die sie nicht festhält und am Wunder ihres Vergessens teilhaben darf. Sie blendet sich aus ihrem Leben aus, wie sie's sich gewünscht hat und ich darf dabei sein und alles wahr finden, was ich gelernt habe. So klein und unwissend kommt man ins Leben und muss alles Lernen, auch sie hat das, und nun sagt sie mir Sachen, ich wäre die Zärtlichste von allen. Ich weine ein bisschen und wische über die Tränen mit dem rauhen Wollpulli. Ihr Zeigefinger streicht um meine Augen herum. Als ich erzähle, was für dunkle Augenringe meine Nachbarin hat, so huuh, lachen wir beide. Ich kenne dich schon mein ganzes Leben, sag ich, und wir sind uns immer so nah gewesen, ein nahes Leben, sie schaut mit ihren großen graugrünen Augen direkt in mich rein, lange, und wie immer denke ich, jetzt ein letzter Atemzug, aber bisher hat sie immer weiter geatmet. (Und ich weiß nicht, ob ich bei jenem dabei sein möchte. Und immer noch kann ich mir nicht vorstellen, dass sie eines Tages wirklich aufhört.) Und noch eine Woche und noch ein Monat, was für ein Jahr das war! Was für ein Leben mit ihr! Was für ein langer Abschied. Aber auch ich vergesse – was war, wie schwierig beide Eltern, wie unglücklich ich mit ihnen – und habe nur noch Liebes für sie übrig.
Ich hätte gedacht, ein Sterben mitanzusehen, wäre schlimmer. Dass ich immer weinen müsste, so wie jetzt, weil ich schreibe. Wenn ich aber bei ihr bin, seit dem Schlaganfall jeden Tag, bin ich ganz ruhig und eine nicht geahnte Freude ist in mir und Kraft. Möglicherweise bin ich die einzige, die sie nicht festhält und am Wunder ihres Vergessens teilhaben darf. Sie blendet sich aus ihrem Leben aus, wie sie's sich gewünscht hat und ich darf dabei sein und alles wahr finden, was ich gelernt habe. So klein und unwissend kommt man ins Leben und muss alles Lernen, auch sie hat das, und nun sagt sie mir Sachen, ich wäre die Zärtlichste von allen. Ich weine ein bisschen und wische über die Tränen mit dem rauhen Wollpulli. Ihr Zeigefinger streicht um meine Augen herum. Als ich erzähle, was für dunkle Augenringe meine Nachbarin hat, so huuh, lachen wir beide. Ich kenne dich schon mein ganzes Leben, sag ich, und wir sind uns immer so nah gewesen, ein nahes Leben, sie schaut mit ihren großen graugrünen Augen direkt in mich rein, lange, und wie immer denke ich, jetzt ein letzter Atemzug, aber bisher hat sie immer weiter geatmet. (Und ich weiß nicht, ob ich bei jenem dabei sein möchte. Und immer noch kann ich mir nicht vorstellen, dass sie eines Tages wirklich aufhört.) Und noch eine Woche und noch ein Monat, was für ein Jahr das war! Was für ein Leben mit ihr! Was für ein langer Abschied. Aber auch ich vergesse – was war, wie schwierig beide Eltern, wie unglücklich ich mit ihnen – und habe nur noch Liebes für sie übrig.
Topic: Musik
Ist im Frühjahr sechs Jahre her, dass ich nicht mehr in der Band spiele. Keine Reue. Heute das erste Mal, dass ich sie sehe. Immer noch keine Reue, aber ich erkenne das Gefühl von Gemeinschaft und Aufregung, das ich damals hatte. Ich am Bass – ein bisschen hochgestapelt, der jetzige Basssist kann das viel besser, er gibt sogar Melodien, während ich mehr oder weniger vor mich hingeachtelt oder -geviertelt hatte. Der zweite Gitarrist macht die Songs lebendiger, drei der Stücke kenne ich noch und die neuen Sachen gefallen mir auch, aber ich nähre mich bloß von der Erinnerung des Gefühls, das jetzt lange hinter mir liegt. Ich höre nicht mehr gerne Musik, fast gar nichts, und oft, wenn ich irgendwo bloß eine Zeile oder bekannte Sequenz höre, dudelt es in mir weiter über Tage, unerhebliches Zeug und nervig in seiner Schleife.
Es ist vieles aus Bildern gemacht. Eine Bassistin sein, bewundernde Blicke bekommen, und vielleicht sogar cool gefunden zu werden. Damals hätte es mir viel bedeutet, obschon wir in keiner Weise bekannt waren, irgendwie lokal, höchstens. Der Rückblick befremdet mich, ich verteile Lob, stelle meine leere Bierflasche zurück auf den Tresen und gehe ohne mich zu verabschieden nach Hause.
Es ist vieles aus Bildern gemacht. Eine Bassistin sein, bewundernde Blicke bekommen, und vielleicht sogar cool gefunden zu werden. Damals hätte es mir viel bedeutet, obschon wir in keiner Weise bekannt waren, irgendwie lokal, höchstens. Der Rückblick befremdet mich, ich verteile Lob, stelle meine leere Bierflasche zurück auf den Tresen und gehe ohne mich zu verabschieden nach Hause.